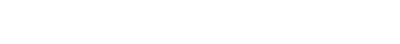Offene Antwort an die Kritiker

Offene Antwort an die Kritiker
»Sie sprechen nicht zu uns...«
Intendant Uwe Eric Laufenberg antwortet den Kritikern in einem offenen Brief anlässlich seiner Inszenierung von »Otello« am Hesssichen Staatstheater Wiesbaden.
Peter Kümmel hat in der »Zeit« (N37 / 2015) einen höchst interessanten Artikel geschrieben: »Sie sprechen nicht zu uns«. Gemeint sind die deutschsprachigen Schauspieler und Regisseure, denen ein gestörtes Verhältnis zur Tradition attestiert wird, die klassische Figuren nicht mehr zum Leben erwecken können und als Zombies über die Bühne irren lassen. Wer nur ein wenig verschiedene Bühnen in deutscher Sprache besucht, wird wissen, über was Peter Kümmel redet.
Aber auch etliche Kritiker und Theaterbeobachter sind von nämlichem Bazillus erfasst: »Sie sprechen nicht mehr.« Sie können eine Aufführung jenseits dicker Ausrufezeichen und lauter Konzeptionsverkehrsschilder nicht mehr erkennen oder »lesen« und so auch nicht beschreiben.
Als Beispiel sei die letzte Premiere am Hessischen Staatstheater – Shakespeares »Otello« in der Vertonung von Giuseppe Verdi – angeführt. (Man könnte diese Fallbeispiele auch mit anderen Aufführungen, die ein ganzes Werk abzubilden versuchen, etwa »Hamlet« am Hessischen Staatstheater beschreiben.)
Verdi und Boito haben ja bekanntlich den ersten Akt Shakespeares gestrichen und setzen ohne Vorspiel mit dem sogenannten »Sturmchor« wie ein peitschendes Naturereignis ein. Ohne Lichtveränderung im Saal, die Aufführung hat sozusagen noch nicht begonnen, steht ein Mann, Jago, auf und sagt Texte aus dem ersten Akt von Shakespeares »Otello«. Dann geht er auf die Bühne, reißt einen schwarzen Gazevorhang herunter und schlagartig beginnt der »Sturmchor«, ohne weitere Vorankündigung, ohne Dirigentenapplaus oder andere Theaterrituale.
Der Anfang ist also zunächst einmal ein Effekt, auch eine Überrumpelung, die überraschen soll. Es wird kritisiert, dass dieser Anfang die Wucht des »Sturmchors« schwäche, das Ziel war aber eine Steigerung. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Es wird kritisiert, dass Jago dasselbe am Anfang sage, wie nachher in seinem Credo im zweiten Akt. Das allerdings ist einfach nur falsch.
Jago eröffnet im ersten Akt Shakespeares ein Thema, das für die Sicht auf das Stück und seine Charaktere immanent ist: »In uns selbst liegt, ob wir so sind oder anders. Unser Körper ist ein Garten und unser Wille der Gärtner.« Jago behauptet also, wir entschieden in Freiheit, welches Leben wir führen wollen. Er wird aber Otello durch seine Intrige dieser Freiheit berauben. Otello wird von Jago, von einer Verlustangst und seinem mangelnden Selbstvertrauen in eine grenzenlose Gefühlsraserei getrieben. Otello wird durch Jago die Entscheidung zwischen Trieb und Vernunft genommen. Weil Jago beweisen will, dass der Trieb, erst recht bei einem Schwarzen, den er fürchtet und von dem er sich nicht degradieren lassen will, immer die Vernunft austreiben und besiegen wird. Die Voranstellung dieser Texte aus dem ersten Akt ist also eine inhaltliche Setzung.
Auch eine andere Dimension tut sich mit dieser Frage auf, eine nach der Schicksalsgebundenheit der Menschen und ihrer Vorstellung, ob diese durch Religion zu »bändigen« sei.
Also: Ist unser Schicksal etwas Vorbestimmtes, in uns Angelegtes, mit dem wir geboren werden? Oder gestalten wir unser Schicksal, greifen wir in den in uns angelegten Plan bewusst ein? Was natürlich auch letzte Fragen impliziert: Wird uns Gott am Ende vergeben, wie auch immer, wie es die christlichen Religionen in ihren Hauptlinien propagieren, oder wird am Ende abgerechnet, wie es die ideologischen Nebenwege der monotheistischen Religionen androhen?
Otello wird durch Jago die Entscheidungfreiheit entzogen, paradoxerweise will Jago so beweisen, dass es die Entscheidung im Prinzip zwar gäbe, aber nicht, wenn man sich, wie Otello, andauernd »falsch« entscheidet, gegen die Vernunft. Für Jago zählt auch die Liebe als Eintrübung der Vernunft.
Eigentlich doch eine spannende Grundlage für ein bewegendes Drama, das klug gesetzten Charakterkombinationen viel Raum lässt für diese doch uns alle angehenden Fragen, so dass sich ein reiches Spiel entfalten könnte, das sich gründlich diskutieren und beschreiben ließe.
Nur eben kein Konzept, das auf diese Ausgangssituationen vorgefertigte Schablonen und Lösungen zeigt, oder durch Bilderrätsel bestechen will.
Die Oper von Verdi durchschreitet in vier Akten den Weg vom offenen Chaos der sich überschlagenden Naturgewalten (»Sturmchor«) durch einen halb offenen Ort der Möglichkeiten und Begegnungen. Dann wird im dritten Akt der offizielle und geordnete Staatsakt gezeigt (den Otello mit einem Gefühlssturm in Unordnung bringen wird) bis wir zuletzt (vierten Akt) im intimsten und abgeschirmtesten Raum des Menschen sind: im Schlafzimmer.
Das Bühnenbild besteht aus Säulen, die zu Anfang wie eine Festung gegen das anstürmende Meer scheinen und durch Sandsäcke abgedichtet sind. Im Weiteren werden sich die Säulen in einen Quergang öffnen, dann den Staatsakt nur noch demonstrativ umstellen, um im Schlafzimmer zu einem trügerischen Bollwerk zu werden. Dort ist das Ehebett durch einen weißen Vorhang und einen weißen Baldachin »geschützt«. Otello wird beides in zwei klar von Verdi kompositorisch gesetzten Momenten herabreißen und das Bett, in und an dem beide, Desdemona und Otello, sterben, wird wie eine kleine Insel, ein kleines Objekt im schwarzen Nichts übrigbleiben.
Auch vor dem Staatstheater stehen Säulen. Sie stehen für Würde, Größe, Staatsmacht, Erhabenheit und ästhetische Schönheit. Sie stützen das repräsentative Kurhaus und Staatstheater. Auf der Bühne stützen die Säulen nichts. Sie stehen wie für sich selbst als Monumente von Macht, die nichts mehr abwehren oder behausen können. Das Dach über Ihnen und der Himmel darüber sind leer. Nur zum Ende des ersten Aktes, wenn Desdemona und Otello glauben, ihre Liebe für immer schützen und bewahren zu können, als Otello aber schon ahnungsvoll betet: »Lass mich sterben, glücklicher kann ich nicht werden«, erscheint hinter der hinteren Säule ein Meeresprospekt mit einem dämmrigen Übergang von Nacht zu Tag.
So ein Bühnenbild als Rahmen einer Spielhandlung von Shakespeares / Verdis »Otello« kann man mögen oder nicht mögen, beschreiben oder nicht beschreiben. Aber als Beweisführung dafür, dass sich das Produktionsteam nichts gedacht habe, als Beweis für Banalität taugt es nicht. Aber Säulen scheinen dem typischen Rezensenten prinzipiell und total die Sicht zu verstellen, sie scheinen darüber hinaus nichts mehr wahrnehmen zu können.
Shakespeare hat der unschuldigen, treuen Frau Desdemona, die wegen eines unbegründeten Verdachts von ihrem Ehemann erwürgt wird, eine andere Figur hinzugefügt, die Prostituierte Bianca, die das tut und ist, als was Desdemona sich von Otello zu Unrecht beschimpfen lassen muss.
(Wie überhaupt in Venedig zur Dogenzeit, in Europa zur Verdizeit und natürlich auch in unserer aufgeklärten westlichen Zivilisationszeit die sexuelle Freizügigkeit der Allgemeinheit und der Moralanspruch an den Einzelnen weit auseinander klaffen.)
Diese Prostituierte Bianca liebt nun über alles den von Otello degradierten Cassio, von dem Otello durch Jago glauben gemacht wird, er hätte ein Verhältnis mit Desdemona. Cassio kann mit Bianca machen, was er will, sie ist ihm verfallen. Bei Verdi tritt sie eigentlich nicht mehr auf, sie ist aber für die Taschentuchintrige auch bei Verdi im Hintergrund weiter wichtig (Cassio redet von Bianca, Otello denkt, er rede von Desdemona...)
Unsere Aufführung lässt Bianca auftreten, sie beim Besäufnisgelage am Siegesfeuer zugegen sein, wie andere Prostituierte, sie versucht Cassio vom dem für ihn gefährlichen Alkohol abzuhalten, sie übergibt ihm (absichtlich? / nicht absichtlich?) Desdemonas Taschentuch, sie sitzt am Ende des dritten Aktes Zigarette rauchend da, als Jago den »Löwen« Otello in den Zusammenbruch einer Ohnmacht getrieben hat. Die hellsichtige Ironie Shakespeares ist es, der die Liebe der Desdemona unter den Gewalt-Attacken Otellos im dritten Akt fast erlöschen lässt und die Prostituierte Bianca bei allen Attacken und Untreue Cassios mit großer Liebe an ihn gefesselt hält. Andersherum stellt sich ja auch die Frage: Hätte Desdemona wirklich mit Cassio und / oder anderen ein Verhältnis, wäre Otellos Mord gerechtfertigt? Davon scheinen zumindest alle Männer im Stück auszugehen, wir wissen, dass ganze Kulturkreise und die Religionen in ihren verschieden Entwicklungsphasen genauso über das gebotene Verhalten und die gerechte Bestrafung von Frauen denken und dachten.
Nicht nur deswegen ist in unserer Aufführung Bianca in Jagos Credo anwesend.
Bianca, die schmutzige Hure, ist als Beweisführung Jagos besonders tauglich:
»Aus dem Dreck der Keime und der Atome // Bin ich gemein geboren«.
Dieses dem Körper verhaftet sein, an ihn gefesselt sein, kann so spielerisch, sozusagen zu einem tierischen Spiel zu Verdis heftig bewegter Musik ausagiert werden. Jagos Fluch ist diese Fesselung an den Körper, auch die Fesselung vom Körper des Mannes an den Körper der Frau, aus der er entsteht und zu dem er sich triebhaft gebunden fühlt. Jagos Verstand will eine andere Antwort, er fragt nach Gott, nach einer weiteren Instanz und weil er diese nicht erkennen kann, verneint er Gott. Sein Verstand sagt ihm, es gibt keinen Gott. Mit den Worten: »Nach all dem Spott kommt der Tod« ruht er für Momente mit seinem Kopf auf dem Bauch der wie eine Leiche daliegenden Frau, er fragt, was kommt dann, streicht ihr zwischen die Beine, schleckt an seiner Hand den Urschleim alles Lebens und singt dann: »La Morte é il Nulla« (Der Tod ist das Nichts).
Jago hat große Brüder: Franz Moor in Schillers Räubern, auch Richard III sind Verwandte, alles »Bösewichter«, die aufgrund ihrer (unbefriedigten?) Sexualität und in scheinbarer Unabhängigkeit von jeder moralischen Ordnung im Angesicht eines scheinbar sinnlosen Todes zu allem Unmenschlichen und zu jedem zerstörerischen Verbrechen fähig sind. Gestern, heute und wohl auch morgen. Für uns alle erlebbar.
Bei Otellos Sturz erfolgt das scheinbar Umgekehrte: Der letzte Akt ist ein Vermächtnis Verdis an diese Welt, wie seit dem Ende seiner Oper »Aida«, seit dem Requiem alles Verdis letzte Worte sein sollten, hatte er doch vor, sich mit dem jeweiligen Werk von der Welt zu Verabschieden und nichts weiteres mehr zu komponieren: Desdemonas über die Maßen anrührendes Lied der Magd Barbara, die von ihrem Geliebten verlassen wurde und deren Lebensbaum eine Trauerweide wurde, deren Salce von himmlischen Hornsäufzern beantwortet wird, trauert um eine Liebe, die größer ist als das Leben, als sie selbst war, die alles ausgefüllt hat, aber nur für einen Moment, der nun vergangen ist.
Dasselbe erkennt Otello nachdem er Desdemona getötet hat und bevor er sich tötet. »Otello fu« (Otello war), nur die Liebe Otellos war groß. Und als er sich den tödlichen Stich zugefügt hat, versucht er Desdemona noch einmal zu küssen (»un altro bacio...«). Auch damit scheitert er. Er erreicht die Tote nicht mehr. Aber Verdi erzählt in seiner Musik, die aus dunklem Untergrund das Kussthema wieder aufleuchten lässt, dass es zwischen den Menschen dieses göttliche Band gibt, ob wir es Liebe, Vertrauen oder Zärtlichkeit nennen. An ihr zu scheitern ist menschlich, sie zu leugnen oder bewusst zu zerstören, ist Frevel. Die Aufführung versucht mit Shakespeare und Verdi Jago und Jagos Verstand ernst zu nehmen und ihm doch zu widersprechen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Nun sind Theateraufführung für den Moment gemacht. »Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze«, wusste Schiller. Beim Geschriebenen, dem Buch, auch bei einem Bild oder einem Film ist das anders. Denen können weder Fehlbeurteilung, Missachtung noch Beschimpfung etwas anhaben. Die Zeit wird zeigen, was an ihnen ist oder war. Theateraufführung müssen sich im Moment beweisen, sie müssen Strahlkraft besitzen, Spannung. Die Darsteller müssen eben mit hoher Einfühlung die Emotionsdichte ihrer Figuren erfassen, durchspielen und darstellen, in der Oper nah geführt an der musikalischen Komposition. Bei »Otello« sind es Emotionserruptionen, die Verdi genau und genial komponiert hat. Dieses musikalisch und darstellerisch wirklich zusammen geboten zu bekommen, ist selten. Theateraufführungen sind immer anfällig für Spannungseinbrüche, Langeweile und Unverständnis. Deswegen spucken sich die Mitwirkenden vor einer Premiere gegenseitig über die Schulter, um den Teufel des Scheiterns zu vertreiben, vor dem niemand wirklich gefeit ist. In den »Otello«-Endproben hatten wir mit Stimmproblemen und Spannungsschwankungen zu tun. Die Premiere war aber zum Glück das Beste, was wir erreichen konnten, sie gelang und wurde vom Publikum auch als solches gewürdigt und belohnt.
Aber auch in nicht ganz gelungenen Aufführungen könnte ein Feuilleton helfen, den Sinn einer Aufführung zu ergründen, auch die Gründe ihres Scheiterns aufzuspüren. Das geschieht im Feuilleton aber sehr oft nicht mehr. Man begnügt sich mit Schlagworten wie »schwache Aufführung, gelungene Aufführung«, ja man schwingt sich auf zu attestieren: »Die Vorgaben des Komponisten werden sauber umgesetzt..., Kenner des späten Verdi und nachdenkliche Naturen wird das kaum trösten.«
Nur - wenn das Feuilleton nicht artikulieren und denken will, und so nicht zu uns sprechen kann, warum wundert es sich dann, dass es viele Aufführungen auch nicht mehr können? Braucht es das Feuilleton dann noch oder reicht nicht doch die Flut von subjektiven Meinungen, die uns aus dem Internet entgegen schwappt und ja eh bald die Arbeit der gedruckten Zeitung zu übernehmen droht?
Natürlich macht in Zeitungen formulierte Kulturpolitik auch das ihre: Wen man nicht leiden kann, wen man als zu mächtig ansieht oder zu überheblich, aus welchem Grund auch immer, der wird gebissen und wenn es schlimm kommt, gehetzt.
Zum Beispiel wird die Behauptung, wir hätten in Wiesbaden das Opernensemble abgeschafft, obwohl diese Behauptung jeder Grundlage entbehrt, gebetsmühlenartig wiederholt. Die Sänger der Premiere des »Otello« sind in festen Verträgen, drei von ihnen haben Residenzverträge, keiner ist nur Gast für diese eine Produktion. Ich glaube allerdings nicht, dass das für das Gelingen einer Opernaufführung wirklich eine Rolle spielt. Deswegen finde ich diese »kulturpolitische« Diskussion sinnlos. Aber das will man eben nicht zur Kenntnis nehmen, weil man eine Ideologie des »alten«, anscheinend nicht reformierbaren Stadttheaters, verteidigen will. Mit der alten Funktion des Feuilletons, sich sinnhaft beschreibend einer Aufführung zu nähern, will man aber anscheinend auch nichts mehr zu tun haben.
»Sie sprechen nicht zu uns...«
Vielleicht sind auch die Richtungen zu sprechen durcheinander. Wofür dieser Aufsatz ein Beweis sein könnte.
Ich glaube aber, dass es sich immer wieder lohnt, es wenigstens zu versuchen: zu sprechen, zuzuschauen, zu denken und zu fühlen, eine Theateraufführung zu gestalten und stattfinden zu lassen, diese anzusehen, sich auszutauschen, und damit zu versuchen, (sich) zu verstehen.
Uwe Eric Laufenberg
LINKS
»Desedemona wird geradeaus um die Ecke gebracht« von Benedikt Stegemann, F.A.Z., 19.9.2015
»Schwacher Start der Opernsaison mit Verdis »Otello« in Wiesbaden« von Volker Milch, Wiesbadener Kurier, 19.9.2015
»Keine Tricks« von Stefan Schickhaus, Frankfurter Rundschau, 19.9.2015
»Großes Theater in Wiesbaden« von Franziska Stürz, Deutschlandradio, 17.9.2015